John Kessel gehört ohne Frage zu den besten Kurzgeschichtenautoren des Genres. In den achtziger und neunziger Jahren hat er alleine jeweils einen Roman veröffentlicht. Nach einer gefühlten Unendlichkeit ist er mit „The Moon and the Other“ zu den langen Arbeiten zurückgekehrt. Während seine zweite Soloarbeit „Corrupting Dr. Nice“ eine wilde Persiflage sowohl auf das Zeitreisengenre wie auch die Srewball Komödie ist, wirkt sein erster Roman „Gute Nachrichten von den Sternen“ wie ein Rundumschlag geschrieben im Jahre 1989 auf die Millenium Hysterie, auf die religiösen Exzesse skurriler Prediger und schließlich auch auf die UFO Hysterie.
Das große Problem des ganzen Epos ist, dass John Kessel weniger seinen Stärken wie die Zeichnung von glaubwürdigen Charakteren in extremeren Situationen, pointierte sozialkritische Anekdoten und aus normalen Begegnungen heraus überschießende Situationen vertraut hat, sondern von Beginn an die große Geschichte im Auge hatte, die in dieser Form nicht abschließend überzeugend ist und vor allem stellenweise wie ein Puzzle aus den unterschiedlichen Versatzstücken nicht diszipliniert genug zusammen gesetzt erscheint.
Wer sich weniger auf den ganzen Plot, sondern eher auf die einzelnen Situationen einlässt, wird ausgesprochen kurzweilig unterhalten. Vielleicht sollte man vor allem aus heutiger Sicht „Gute Nachrichten von den Sternen“ als eine Art visuelle Zeitreise in die späten achtziger und frühen neunziger Jahre betrachten. Eine geführte Wanderung durch eine Zeit, die viele von John Kessels Lesern zwar auf der einen Seite selbst erlebt haben, die aber dank der verklärten Erinnerungen inzwischen sehr weit entfernt ist.
Durch das Buch zieht sich im Grunde ein roter Faden. George Eberhart ist verstorben. Die Nachrichtenfirma, für die er nicht nur gearbeitet hat, sondern vor allem schwierige Fälle löste, hat ihn illegal wiederbelebt. Im Grunde als Persona-Non- Grata arbeitet er weiter an den brisanten Fällen, obwohl niemand abschließend die Verantwortung für seine Wiedergeburt übernehmen möchte. Seine Frau Lucy verliert ihren Job wegen ihrer Rolle in der unchristlichen Wiederbelebung.
Philip K. Dick hätte aus der Idee eines Menschen, wiedergeboren gegen alle Gesetze oder sozial- christlichen Vorstellungen genau die Paranoia Geschichte gemacht, die John Kessel verzweifelt sucht. Die Stärke Dicks war immer die Zeichnung von glaubwürdigen Protagonisten. Der Leser muss sich in John Kessels Roman nicht nur orientieren, viel schlimmer ist, dass der Autor keine Sympathieebene zu den einzelnen Protagonisten aufbaut. John Kessel springt nicht nur zwischen den einzelnen Nebenfiguren hin und her, er nimmt sich wenig Zeit, mit George Eberhart und weniger seiner Frau einen zentralen Charakter zu etablieren.
Dabei gibt es ausreichend Ansätze. Der Wiederauferstandene – kein Wunder, dass Kirchen und Sekten gegen den Prozess protestieren – entfremdet sich von den kommerziell sensationslüsternen Zielen seines Job und gleichzeitig auch von s einer Frau. Im Grunde wirkt er plötzlich wie ein Fremdkörper. Ob das an dem sich stetig steigernden Wahnsinn liegt oder er damit begründet werden kann, dass George Eberhart normal wieder, bleibt unausgesprochen.
George ist das verbindende Element zu den Außerirdischen, die entweder pünktlich am 31.12.1999 ihre Invasion beginnen oder schon seit vielen Jahren unter den Menschen leben. Sein Kumpel Richard – er hat offiziell seinen Job nach dessen Ableben geerbt – sieht in den Außerirdischen eher eine Art Ablenkungstaktik eines Massenpredigers, der dritten wichtigen Gestalt des Buches. Richard versucht Verbindungen zwischen den fiktiven Fremden und dem Superprediger Jimmy- Don Gilray herzustellen, der natürlich genau für dieses Silvester das Ende der Welt propagiert.
Jimmy-Don Gilray ist in der Theorie die am meisten charismatische Figur des Buches. Ein Scheinheiliger, der es liebt, selbst im Rampenlicht zu stehen und mit dem Finger auf die Menschen zu zeigen, deren Schwächen er selbst unglaublich gerne hat. Die Bibel ist eine Art Interpretationsbroschüre für ihn. Natürlich zieht er mit dieser Doomsdaypropaganda die Scharen der Leichtgläubigen, der Naiven und auch der wirtschaftlich Abgehängten wie das Licht die Motten an.
George Eberharts Suche nach dem oder den Außerirdischen ist der rote Faden, der nach einem soliden, ein wenig phlegmatischen und unstrukturierten Auftakt das Buch zusammenhält. Einzelne Ereignisse ergeben isoliert voneinander betrachtet keinen Sinn. Sie wirken wir die skurrilen Nachrichten aus der Tageszeitung. Zusammengelegt und vielleicht auch chronologisch betrachtet implizieren sie die Möglichkeit, das ein Außerirdischer erstaunlich sadistische Spiele mit einer Reihe von durchschnittlichen Menschen treibt, die George Eberhart und der Leser zeitgleich kennenlernen. Wie in einer Reihe von populären UFO Büchern macht sich John Kessel einen Spaß daraus, die Phänomene zu beschreiben, aber an keiner Stelle zu erklären.
Durch diese nicht immer leichte und hinsichtlich mancher Klischees aus gefährliche Vorgehensweise kann John Kessel einige seiner Schwächen als Romancier ausgleichen. Diese Vignetten sollen das irrsinnige Leben um die Jahrtausendwende allerdings aus der Perspektive der achtziger Jahre beleuchten. Als Ganzes wirkt das Buch überambitioniert. John Kessel möchte nur nicht alle Themen von den angesprochenen Fernsehpredigern über Konsumexzesse bis zur UFO Hysterie anreißen, er möchte sie jeweils für einen Moment in den Mittelpunkt stellen und verliert dadurch phasenweise den Überblick. Einzelne Segmente erscheinen zu hektisch abgeschlossen, andere ziehen sich viel zu lange hin.
Mit dem Mittel der Übertreibung punktet er lange Zeit vor allem mit seiner Kritik an den dogmatischen Pseudopriestern, die sich in erster Linie mit der Naivität ihrer Gläubigen die Tasche voll machen. John Kessel kritisiert dieses Verhalten aber nicht nur, zu den Stärken des Buches gehört, dass er die Opfer ausgesprochen sympathisch und bodenständig zeichnet, um die entsprechende Tragik besser zum Ausdruck zu bringen. Das steht in einem starken Kontrast zu den überzeichnet erscheinenden „Helden“, die alle ihre dunklen Seiten in stetiger Reihenfolge präsentieren, bevor im Grunde datumstechnisch perfekt das „letzte Silvester“ die Handlung auf den Kopf stellen sollte.
Das ist aber leider nicht der Fall. Filme wie Katherine Bigelows „Strange Days“ haben bewiesen, die man die Spannungsschraube effektiv auf einen einzigen Punkt bringt. John Kessels Buch verliert an diesem Abend an Faszination, weil er Autor erkannt hat, dass er lange Zeit auf zu vielen Hochzeiten getanzt und zu viele Gäste leider an unterschiedlichen Orten eingeladen hat.
Aus heutiger Sicht wirkt seine dunkle Vision – zusammen mit Gore Vidals „Messiah“ in dieser kleinen Subkategorie ein wichtiges Buch – fast bieder. Die provokanten Schlagzeilen und Fernsehsendungen haben sich zusammen mit der Realiy TV Manie unglaublich vermehrt und einzelne Ideen, die zynisch sarkastisch gemeint sind, hat die Realität inzwischen überrollt.
„Gute Nachrichten von den Sternen“ ist ein unglaublich vielschichtiges, aber auch ermüdend zu lesendes Buch, das wie eine John Kessel Kurzgeschichte am Besten in einzelnen Kapiteln goutiert wird. Als zusammenhängender Roman versucht John Kessel seine Leser entweder mit den zahlreichen Facetten und Nebenhandlungen zu erschlagen oder wie sein Fernsehpriester manipulativ zu überrollen. Beide erreichen nicht unbedingt ihr Ziel und diese Übertreibung lässt einzelne Facetten untergehen. Philip K. Dick hat seine Romane subtiler, vielleicht auch hintergründiger und intelligenter aufgebaut, während John Kessel „Gute Nachrichten von den Sternen“ als das Buch geschrieben hat, mit dem er alles sagen möchte. Und das hat selten funktioniert.
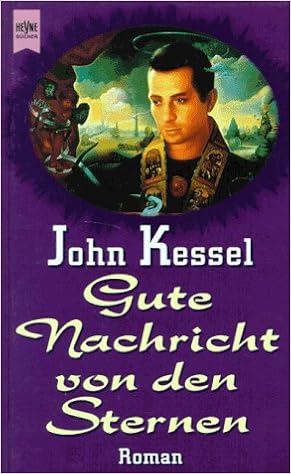
- Broschiert: 571 Seiten
- Verlag: Heyne; Auflage: Dt. Erstausg. (1996)
- ISBN-10: 3453094662
- ISBN-13: 978-3453094666
