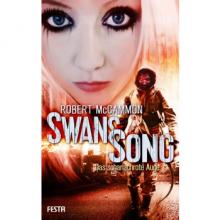
Der Festa- Verlag hat Robert McCammons ursprünglich 1987 veröffentlichten und mit dem Bram Stoker Award ausgezeichneten Roman „Swan Song“ in zwei separaten Taschenbüchern veröffentlicht. Aus heutiger Sicht vor allem angesichts der qualitativen Weiterentwicklung McCammons muss angemerkt werden, das der Roman aus der frühen Phase des Autoren stammt, in welcher er nicht nur eine eigene Stimme suchte, sondern sich auch mehrmals den Vorwurf gefallen lassen musste, als Schriftsteller talentiert, aber nicht unbedingt originell zu sein. Auch „Swan Song“ weißt Ähnlichkeiten zu Stephen Kings „The Stand“ auf. Beide Romane handeln sehr episch den Weltuntergang ab.
In beiden Büchern müssen die Charaktere überwiegend durch die zerstörte USA reisen. In beiden Büchern gibt es Manifestationen des Teufels, wobei beide Autoren die Idee des Bösen durch bedrohliche Charaktere im Grunde ohne Namen übernehmen. In beiden Büchern gibt es abschließend Hoffnung, dass die Zivilisation auf einem bescheidenen Niveau nach den Kriegen wieder auferstehen kann.
Ein großer Unterschied zwischen den beiden Büchern ist nicht nur Swan, die in McCammons Buch über heilerische Fähigkeiten verfügt und quasi in der verstrahlten und verbrannten Erde wieder Getreide wachsen lässt, sondern vor allem auch der Ausgangspunkt der Katastrophe. McCammon folgt den Tagen des Kalten Kriegs und lässt die Welt in einem atomaren Feuer untergehen, das vor allem durch eine Kette von Missverständnissen und vor allem Provokationen ausgelöst worden ist. Dadurch ist er Stephen King hinsichtlich der Zerstörung der menschlichen Grundlage einen Schritt voraus.
Während Stephen Kings Superschnupfen zumindest die Infrastruktur in Takt gelassen hat und den Überlebenden die Chance einräumte, sich aus den zurück gelassenen Vorräten zu versorgen, nimmt McCammon seinen sich auf der Quest befindlichen, leider nicht immer dreidimensionalen Figuren diese Möglichkeit. Der Leser kann den atomaren Schlagabtausch aus verschiedenen Perspektiven verfolgen.
Von Ihnen aus Sicht des amerikanischen Präsidenten, der im Gegensatz zu seinen Militärs nicht davon überzeugt ist, das Richtige für sein Land zu tun. Dann wechselt der Schauplatz. In den Bergen irgendwo im Nichts befindet sich eine Bunkeranlage, in welcher die Menschen sich quasi Plätze für das Holocaust buchen können. Nur ist die Anlage brüchig und die Überlebenschance gering.
Zu den eindrucksvollsten Szenen gehört die Begegnung einiger Menschen in einer kleinen brüchigen als Tankstelle genutzten Holzhütte, hinter der plötzlich aus dem Nichts heraus die amerikanischen Atomraketen aus ihren seit Ewigkeiten getarnten Silos starten und auf beiden Seiten die fiktiven Front Schaden anrichten. McCammon wechselt zu Beginn ausgesprochen schnell die Perspektive, führt alle relevanten Charaktere innerhalb weniger im Grunde hundert Seiten ein, bevor nach der Apokalypse das große Verschieben beginnt. Die Dynamik der ersten Ereignisse kann der Autor nicht aufrecht erhalten und es ist aus der Distanz von fast dreißig Jahren auch schwierig zu sagen, was vielleicht gekürzt hätte werden können, aber der eigentliche Spannungsbogen sackt im Mittelteil ab.
McCammon greift zu sehr auf bekannte Strukturen zurück und verzichtet darauf, die Questidee zu relativieren. Zum Showdown müssen sich alle Überlebenden – es gibt einige, die sich in den wichtigen Actionszenen opfern, aber das sind nicht viele – an einem bestimmten Ort einfinden. Verbindendes Element ist dabei ein seltsames Glasartefakt, das Sister in dem zerstörten Manhattan gefunden und mitgenommen hat. Das Artefakt wirkt wie aus einer anderen Welt und lange Zeit betrachtet es McCammon im Grunde als eine Art MacGuffin, dessen Fähigkeiten eher im Auge des Betrachters wechseln. Der zugänglichste Charakter ist ohne Frage Joshua Hutchins, der als ehemaliger Wrestler inzwischen zu einer Art Hüter der jungen Swan geworden ist. Sie verfügt über die Fähigkeit, die Wunden des Atomkrieges zu heilen.
Dieses übernatürliche Element ist rückblickend der schwächste Punkt des ganzen Romans. McCammon bietet am Ende seiner düsteren Antiutopie eine Art Erlösung an, die er vorsichtshalber frei von jeglichen religiösen Zwängen anbietet. Wie Stephen King konzentriert er sich auf die Idee des Bösen. Er impliziert, dass es natürliche Mächte gibt, die kein Interesse an Swans heilenden Fähigkeiten haben. Kritisch gesprochen hätten diese ominösen dunklen Mächte angesichts ihrer Möglichkeiten die Chance gehabt, Swan zu vernichten und damit das Dunkle siegen zu lassen.
Aber diese Idee wirkt wie ein Kompromiss. Der Anfang des Buches ist unheimlich realistisch und McCammon zeichnet dunkle Bilder des verzweifelten, im Grunde unrealistischen Überlebenskampfes, da es bald kein sauberes Wasser oder unverstrahlte Lebensmittel mehr gibt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die letzten Menschen sterben. In dieser Hinsicht hat Stephen King unabhängig vom dunklen Mann ein sehr viel nachhaltigeres und konsequenteres Szenario erschaffen. Einzelne Szenen ragen immer noch aus der Masse heraus und zusammengefasst ist „Swan Song“ immer noch und vielleicht leider auch wieder ein interessantes und lesenswertes Buch, das mit seinen mystischeren Elementen aber auch teilweise im Vergleich zu den Doomsday High Tech Thrillern antiquiert erscheint.
Die größte Schwäche ist allerdings auch die Zeichnung der Antagonisten. Während sich Mccammon bemüht, die Helden so realistisch wie möglich zu zeichnen und dabei die Eindimensionalität durch pragmatisches Handeln zu ersetzen, wirken viele seine Antagonisten eindimensional. Eine Art Zwitterwesen ist noch der amerikanische Präsident, der entscheidungsunfähig sich schließlich von den Falken unter seinen Militärs überzeugen lässt. Er reagiert auf die Provokationen der Russen und ist schuldig wie unschuldig zu gleich. Mit dem paranoiden Ex Militär und jetzigem Berater in der Bunkeranlage, seinem willigen Helfer und leider auch der im Hintergrund agierenden „bösen“ Präsenz geht McCammon zu viele Kompromisse ein und zeichnet eher ambivalent, aber leider nicht konsequenten Schurken.
Sie akzeptieren die Möglichkeit eines „übernatürlichen“ Artefaktes zu schnell und vor allem wird diese Idee eher aus der Luft gegriffen. McCammon bereitet sie angesichts des Umfangs seines Romans zu wenig konsequent vor. Wenn er sie allerdings eingeführt hat, geht er mit den übernatürlichen Möglichkeiten sehr vorsichtig um und macht aus ihnen bis auf das angesprochene Ende keine „Deus Ex Machina“ Variationen.
In dieser Hinsicht folgt McCammon ohne Frage mehr Richard Mathesons „I am Legend“, wobei der Autor die Einsamkeit seiner Protagonisten – selbst in den kleinen Gruppen, in denen sie durch das Land marschieren, wirken sie ohne Frage isoliert – genauso wie die kleinen Wunder in einfache, sprachlich interessante Bilder gefasst hat. „Swan Song“ ist hinsichtlich seines umstrittenen Endes ohne Frage Stephen Kings „The Stand“ überlegen. Der Plot wirkt trotz der Längen deutlich besser geplant und die Bewegungen der einzelnen Protagonisten bis zur finalen, manchmal ein wenig an die finale Schlacht aus „Der Herr der Ringe“ erinnernden Auseinandersetzung besser und zielstrebiger geplant, so dass die beiden Weltuntergangsepen sich eher ergänzen als das man davon sprechen kann, dass McCammon sich zu sehr hat inspirieren lassen.
Die deutsche Veröffentlichung dieser Ausgabe ist überfällig und ermöglicht jetzt einen direkten Vergleich zwischen Stephen Kings ja in verschiedenen Variationen vorliegendem Epos und dieser zusammenfassend deutlich warmherzigen und unabhängig vom menschlichen Vernichtungsgeist auch auf der kleinsten persönlichen Ebene optimistischen Geschichte.
Swan Song: Buch 1- Nach dem Ende der Welt; Buch 2- Das scharlachrote Auge
jeweils 576 Seiten
Paperback, Umschlag in Festa-Lederoptik
20 x 12,5 cm
ISBN: 978-3-86552-353-2 + 978-3-86552-355-6
Übersetzung von Manfred Sanders

