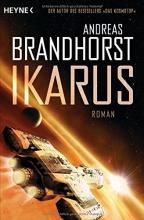
Andreas Brandhorsts Thriller „Ikarus“ ist unabhängig von der zu Beginn packenden Lektüre gegen Ende ein zweischneidiges Schwert. Das größte Problem ist ohne Frage der Klappentext, der hinsichtlich des Universums, aber vor allem auch das „Ikarus“ Projektes zu viele Informationen Preis gibt. Das sich dieses Projekt nicht als die klassische und damit auch typische Allzweckwaffe in „Deus Ex Machina“ Manier entpuppt, ist Kennern Andreas Brandhorsts von Beginn an klar, aber es ist schwierig, Spannung zu erzeugen, wenn im Grunde das Ziel der Suche schon „bekannt“ ist und der Weg dahin nicht immer geradlinig erscheint. Aber nicht nur der Spannungsaufbau ist unabhängig vom interessanten, Klischees des Genres wie die Besetzung durch die allmächtigen Regulatoren geschickt einbauenden Hintergrund ein Problem des Buches.
Brandhorst nutzt eine alte Idee des Krimis. „D.O.A.“ – Death on Arrival – ist mehrfach verfilmt worden. In den Streifen sucht ein vergifteter, sterbender Mann seinen Mörder. Diesen Plot variiert der Autor, in dem sein Held „Jami Jamis Takeder“ gleich zu Beginn des Buches ermordet worden ist. Sein Kopiat – das Gedächtnis ist passend bis auf die letzten zwei wichtigen Tagen aktuell – erwacht ohne Bürgerrechte in einem violetten Körper. Er soll den Mörder des Originals fassen. Dazu steht ihm anfänglich ein Prozent des beträchtlichen Vermögens zur Verfügung. Auf der anderen Seite hat er nur 20 Tage Zeit, bis sein Körper sich zersetzt. Die Erstellung einer weiteren Kopie ist nicht möglich. Diese Prämisse ist auf jeden Fall originell, nur kann der Autor relativ wenig aus ihr machen. Die Zeichnung von Figuren ist bei Andreas Brandhorst immer ambivalent. Sie wirken wie die Welten exotisch, agieren manchmal auch fremdartig, aber die notwendige Wärme, die Dreidimensionalität und vor allem die Tragik der Ereignisse scheinen nur selten durch. Auch wenn sich auf den ersten ideentechnischen Blick sein Werk ohne die bizarren Exkurse in latent sadomasochistische Bereiche mit den „Culture“ Arbeiten eines Iain Banks durchaus messen kann, scheitert der in Italien lebende Autor und Übersetzer nicht selten auf einem hohen Niveau beim letzten I- Punkt. Natürlich ist das Kopiat kein vollwertiger Mensch und kann teilweise in dieser Zukunftswelt auch keine echten Emotionen entwickeln. Aber es fehlt bis auf einige wenige melodramatische Augenblicke der Moment des Ablaufens einer Sanduhr. Während das Original von seinem Tod überrascht worden ist, muss die Kopie damit „leben“, dass niemand ihn wirklich trotz seines Ermittlerauftrages akzeptiert und das er weiß, dass er in zwanzig Tagen sterben wird. Auf eine unangenehme Art und Weise. Anstatt aber diese Idee auch konsequent bis zum bitteren Ende durch zu spielen, weicht der Autor sie am Ende ab. Deswegen überzeugt bei der Takeder Handlung vor allem die Suche nach „Ikarus“. Ohne relevante Informationen, von einer Kommission überwacht und im Grunde von allen Menschen – egal ob es sich um die Witwe oder die Freundin handelt – eher mit Abscheu behandelt, ist Takeder von Grund auf kein sympathischer Mann stark isoliert und versucht durch ein Gestrüpp von falschen Spuren zu schauen. Ergänzt wird dessen Vorgehensweise durch eine Art Extrasinn, die dem Kopiat Informationen zuflüstert. Takeder kann nicht einordnen, ob es die Stimme wirklich gut mit ihm meint oder nicht. Diese Unbestimmtheit, diese Annäherung an die Paranoia des Film Noirs ist ein wichtiger Aspekt des Romans, den ein erfahrener Schriftsteller wie Andreas Brandhorst aber auch durch eine Variation des Stils besser hätte ausbauen können. Die ersten Schritte des Kopiats werden von einer Reihe potentieller Verdächtiger begleitet. Das am Ende der einzige Charaktere im engeren Kreis der Verdächtigen in Frage kommt, der sich dem Kopiat gegenüber am „menschlichsten“ verhält, ist vielleicht die Schwäche des Krimiplots, der insbesondere in der zweiten Hälfte mehr und mehr zu einer Art MacGuffin verkümmert, weil die kosmopolitischen Aspekte den Handlungsbogen zu erdrücken drohen. Andreas Brandhorst verkürzt anschließend die Lebenszeit des Kopiats und entzieht ihm sogar die Ermittlererlaubnis. Das wirkt ein wenig überambitioniert, zumal wegen des Missachtens der Kommission im Grunde der Auftrag sehr viel schneller zu Ende gewesen ist als es die 20 Tage anfänglich suggerierten. Mit diesen Versatzstücken bringt der Autor Takeder vor allem in eine unmögliche Situation. Nur durch Hilfe von außen kann er während der zweiten Hälfte des Buches seinen eigenen „Fall“ lösen. Für einen Krimi zerfasert der Handlungsbogen am Ende zu stark, so dass die Distanz zwischen den einzelnen Figuren – Takeder ist am Dreidimensionalsten, viele andere Figuren ausschließlich funktional eingesetzt – sich erweitert und nicht verkleinert. Insbesondere die weiblichen Figuren – neben der Ex- Frau und die Freundin noch das Mitglied einer Crew – wirken dabei eindimensional, die Dialoge sind nicht unbedingt prickelnd und wirken schematisch. Vor allem klärt Brandhorst nicht die verschiedenen Zusammenhänge zwischen den Figuren über das Rudimentärste hinaus auf. Der Liebhaber bei der Ehefrau, die potentielle Abneigung der Freundin, das schwierige Verhältnis zum Sohn. Das funktioniert alles, es inspiriert aber nicht.
Aus „Picknick am Wegesrand“ hat Andreas Brandhorst eine andere Idee übernommen. Die Menschen leben gut von den Resten – weg geworfen oder gestohlen spielt dabei keine Rolle – der Regulatoren, einem an Banks „Culture“ erinnernden Zusammenschluss von insgesamt zwölf hoch entwickelten Zivilisationen, welche den Expansionsdrang der Menschen unter Kontrolle gebracht haben. Die einzelnen Kolonien sind voneinander abgeschnitten. Wie in der Takeder Handlung konfrontiert Andreas Brandhorst den Leser mit einem ohne Frage exotischen und vielschichtigen Universum, das aber erklärungsbedürftig ist. Da der Roman sich weniger über die kaum erklärten Zusammenhänge, sondern die teilweise subjektive, auf vielleicht nicht richtigen Informationen basierende Perspektive Takeders konzentriert, macht sich der Leser stellenweise nur auf Augenhöhe mit dem Kopiat Gedanken über diese Welt. Während die Liberalisten im Tau Ceti System – hier spielt die Geschichte – die Isolation durchbrechen wollen, gibt es ausreichend Kräfte wie die Creditoren, die Debitoren oder Holder wie Takeder, die wie eingangs erwähnt von der Technik profitieren. Brandhorst bleibt dabei vage und zeichnete die Fremden als Oberhüter, deren Bestrebungen für die laufende Handlung und vor allem die Idee eines Freiheitskämpfers mit einer entsprechenden Waffe teilweise kontraproduktiv und wenig spannungsfördernd erscheinen. Viel mehr konzentriert sich Brandhorst auch mit der Parallelhandlung auf die Vergangenheit und versucht mit einem großen Bogenschlag die Komplexität des Universums dem Leser vor Augen zu halten, ohne wirklich mit Details überzeugen zu können. Je vielschichtiger dieses erscheint, desto mehr lenkt es von der zugrundeliegenden Quest ab und lässt „Ikarus“ eher wie eine Hülle erscheinen, die strahlt, aber auch inhaltsleer ist. Das Geheimnis von „Ikarus“ ist abschließend einer der Höhepunkte des Romans. Futuristisch auf der Mythologie basierend und gut in diese Zukunftswelt eingepasst, bietet der Autor dem Leser ausreichend Möglichkeiten, über dieses Geheimnis nachzudenken, auch wenn es für die Auflösung ein wenig zu optimistisch, zu breit vorbereitet worden ist.
Stilistisch wie viele Andreas Brandhorst Romane zu gleichförmig geschrieben hätten der Struktur Variationen in der Spannungskurve, Tempowechsel und vor allem eine dreidimensionalere Beschreibung der Actionszenen gut getan. Wer Andreas Brandhorsts Bücher aus den achtziger Jahren kennt, wird nicht mehr so überrascht von dieser teilweise frustrierenden Gleichförmigkeit. Es ist schade, dass der Autor im Vergleich zu Banks nicht den Mut gehabt hat, eine Film Noir Idee auch stilistisch dem Genre zugeordnet zu erzählen, so dass „Ikarus“ insbesondere im Mittelteil zu lang, zu gedehnt und bemüht erscheint. Alleine der gute, interessante und packende Auftakt sowie das zufriedenstellende Ende heben den Roman aus der Masse heraus. Die Qualität der letzten beiden von Andreas Brandhorst verfassten Geschichten wird leider nicht erreicht.
Originalausgabe
Paperback, Broschur, 576 Seiten, 13,5 x 20,6 cm
ISBN: 978-3-453-31545-7
Verlag: Heyne
