Wilson Tuckers 1952 entstandener Roman „The Long Loud Silence“ ist zweimal gekürzt und nicht in der vom Autor siebzehn Jahre später überarbeiteten Fassung in Deutschland erschienen. Einmal als Terra Sonderband 4 übersetzt von Clark Darlton unter dem passenden Titel „Das endlose Schweigen“ und in den siebziger Jahren als „Die Unheilbaren“ im Ullstein Verlag. Der Ullstein Titel bezieht sich auf eine Erkenntnis des Protagonisten im letzten Drittel des Buches.
Sowohl der Terra Sonderband als auch die Ullstein Taschenbuchausgabe sind gegenüber der amerikanischen Version gekürzt.
Auch wenn Wilson Tucker auf die Versatzstücke des atomaren wie biologischen Holocaust zurückgreift, handelt es sich um einen ambivalenten Überlebensroman, dessen Schwächen vor allem auf der wissenschaftlichen Ebene liegen, während der alltägliche Kampf um Nahrung eindringlich beschrieben worden ist.
Corporal Russel Gary ist Dreh- und Angelpunkt der Handlung. Der Prolog wirft den Leser mitten in die Szenerie. Erst mit der nächsten Szene holt Gary seine Leser quasi ab und erzählt von seinem verhängnisvollen dreißigsten Geburtstag sowie seinem zehnjährigen Dienstjubiläum. Er wacht nach einer Alkoholdurchzechten Nacht auf und findet sich plötzlich in einem Teil der USA wieder, der von Atombomben, aber auch bakteriologischen Waffen quasi entvölkert worden ist.
Die ersten Tage versucht er in der Stadt zu überleben, wobei Tucker ein eher harmloses Bild zeichnet. Millionen von Toten liegen auf den Straßen. Ratten oder anderes Ungeziefer gibt es quasi nicht. Lebensmittel inklusiv Wasser sind nicht verstrahlt worden. Die Technik funktioniert noch. Er lernt ein junges neunzehn Jahre altes Mädchen kennen, das nicht nur auf Juwelen steht, sondern mit ihm eine Nacht verbringt.
Gary ist ein Überlebenskünstler, der ihre Flucht aus der Stadt organisiert. Angeblich soll es westlich des Mississippi weiterhin so etwas wie eine Zivilisation geben. Allerdings lassen die bewaffneten amerikanischen Kräfte wirklich niemanden über diese natürliche Grenze.
Technisch scheint es unwahrscheinlich, dass angesichts der Verwüstung durch Atom- und biologische Waffen ein selbst so breiter Fluss wie der Mississippi eine Grenze darstellen könnte. E$s gibt auch im Roman keinen klassischen Feind. Gary weiß nicht, wer die USA angegriffen hat. Im Laufe seiner Odyssee erfährt er es auch nicht. Es werden ihm zwar zahlreiche Gerüchte herangetragen, aber es gibt keine Bestätigungen.
Dass die atomare Vernichtung sich erstens auf ein nicht unbedingt überschaubares, aber abgegrenztes Gebiet konzentriert hat und ein verstrahltes Leben in den Ruinen zumindest für eine gewisse Zeit möglich ist, erscheint noch akzeptabel. Schwieriger scheint es, dem Weg der biologischen Waffen zu folgen.
Sie scheint die Menschen auf eine unterschiedliche Art und Weise zu töten. In einer Szene philosophiert Gary darüber, dass die Bakterien wahrschein die Lungen angreifen. An einer anderen Stelle des Romans bleibt Gary in dieser Hinsicht spekulativ vorsichtiger.
Auf jeden Fall kommt er zu der Erkenntnis, dass alle Überlebenden westlich des Mississippis zwar gegen die Bakterien immun sind, aber trotzdem als Überträger fungieren können. Daher der doppeldeutige Titel der „Ullstein“ Ausgabe.
Bis in die Mitte des Buches hinein versucht Gary auf unterschiedliche Art und Weise auf die andere Seite des Flusses zu seiner Einheit zurückzukommen. Dabei agiert er durchaus originell wie rücksichtslos. Das Zeigen der Marke an einer der wenigen noch vorhandenen Brücken funktioniert nicht. Er wird abgewiesen.
Den Fluss durchschwimmen macht jeden Freiwilligen zu einem Ziel der Scharfschützen. Für einen anderen Plan braucht er einen wahrlich dummen „Freiwilligen“, wobei Wilson Tucker in dieser Szene nicht abschließend klar gemacht, ob der Ablauf wirklich so geplant gewesen ist oder Gary einfach aus der Not eine Tugend gemacht hat.
Auf der verseuchten Seite des Flusses kann sich Gary anfänglich mit ein wenig Menschlichkeit „retten“. So überwintert er als Leibwächter auf einer Farm, nachdem er deren Tochter gerettet hat. Später jagt er alleine durch die Wälder. Er scheut sich nicht, Gesindel zu töten und seine Haut aktiv wie rücksichtslos zu verteidigen.
Diese Perspektive ändert sich im Laufe des Buches. Als er eine reelle Chance sieht, den Fluss zu überqueren, ist er auch bereit, Soldaten zu töten, die ihm nichts getan haben und die wie die normale Bevölkerung mit der Situation überfordert sind. Auch im Anschluss ist er bereit, Mitmenschen zu gefährden, um ein wenig Zivilisation zu erleben. Es dauert länger, bis eine nihilistische Erkenntnis bei ihm einsetzt und er zurückrudern muss. Diese emotional wichtigen Szenen erzählt Wilson Tucker zum Leidwesen des Buches aus einer spürbaren Distanz. Die Fokussierung der Handlung liegt alleine auf Gary als Dreh- und Angelpunkt, aber wirklich nahe kommt der Leser diesem ausgebildeten Spezialisten in der Kunst der Kriegsführung nicht.
Die meisten anderen Protagonisten sind pragmatisch gezeichnet worden. Wilson Tucker ist für sein Frauenbild kritisiert worden, aber neben der Farmerfrau und ihrer Tochter sowie einem leichten Mädchen finden sich nur zwei weibliche Protagonistinnen. Die neunzehnjährige Frau „wacht“ wie Gary als aus ihrer Sicht einzige Überlebende in der biologisch „verstrahlten“ Stadt auf. Überall sind Leichen. Sie versucht ihre materiellen Bedürfnisse zu befriedigen, ohne in ihrem Schockzustand zu erkennen, dass sie mit den Juwelen nichts anfangen kann. Wilson Tucker schließt den Roman in dieser Hinsicht mit einer fatalistischen Erkenntnis.
Immerhin ist das junge Mädchen gleich bereit, mit Gary eine Nacht zu verbringen. Und sie teilen sich nicht nur ein Zimmer, wie Wilson Tucker Gary denken lässt. Neunzehnjährige scheinen in den fünfziger Jahren auch schon Erfahrung zu haben. Später zeigt sich, dass die anfänglich an seinem Rockschoß hängende junge Frau aber auch ihren „Mann“ stehen kann. Auch wenn dieser Aspekt während des Romansende untergeht.
Es gibt noch eine Dreierbeziehung zwischen zwei Soldaten und einer jungen Frau. Anfänglich ziehen die beiden ehemaligen Soldaten als Kameraden durchs Land. Als sie ein Mädchen aufnehmen, siedeln sie sich im Süden kann. Das Mädchen ist schwanger, weiß aber nicht wirklich, wer der Vater ist. Da Gary aber weniger Gefühle für die junge Frau zu haben scheint, wird er quasi vor die Tür gesetzt und zieht von dannen. Ein wilder Dreier ist mit einem Neugeborenen nicht mehr möglich.
Zu den besten Szenen des ganzen Buches gehört die kontinuierliche moralische Verrohung des Protagonisten. Tötet er anfänglich nur aus Notwehr greift er später Soldaten und Menschen an. Ist aktiv beteiligt, ihm unterlegene Überlebende aus dem Weg zu räumen und scheut sich auch nicht, waffentechnisch unterlegene Wegelagerer zu erschießen, um seine „Ruhe“ zu haben.
Gary ist zu keiner Sekunde ein sympathischer Protagonist. Diese Szenen lassen die Distanz zum Leser anwachsen. Auf der anderen Seite zeigt Wilson Tucker, das in einer solchen Situation vor allem die Männer überleben, die zum Töten ausgebildet worden sind. Und da kommt es nicht auf Sympathie oder Antipathie an.
Damit gleich der Autor die wissenschaftlichen Unstimmigkeiten seiner Prämisse aus. Der Originaltitel bezieht sich auf das immer Menschenleerer werdende Land, durch dessen Weiten Gary erst auf der Suche nach einer Möglichkeit streift, den Fluss zu überqueren und das ihm abschließend auf einem primitiven Niveau die kleine Chance erhält, abseits der wenigen Farmern und herumstreifenden Banden primitiv wie ein Wilder zu überleben.
Es gibt eindrucksvollere Post Doomsday Geschichten aus den fünfziger Jahren, aber Wilson Tucker ist bereit, die aufgesetzten moralischen Grenzen der Science Fiction Literatur dieser Epoche zumindest ein wenig zu erweitern und anzudeuten, was es wirklich heißt, in einem in die Primitivität zurückgefallenen Land überleben zu wollen.
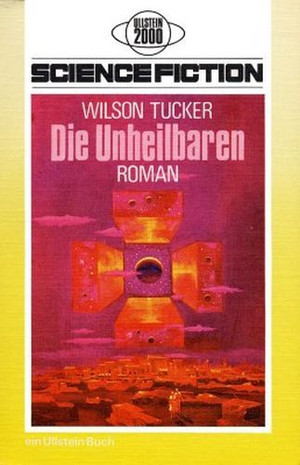
Ullstein Verlag
126 Seiten
