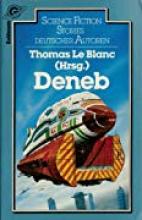
„Deneb“ ist die vierte der Sternenanthologie mit Kurzgeschichten deutscher bzw. deutschsprachiger Autoren. Im Vorwort geht Herausgeber Thomas Le Blanc auf die nicht immer einfacher Auswahlprozesse und die vor allem sprachlichen Anforderungen ein, denen er die Texte unterwirft. Da werden nach eigenen Worten lustlos herunter geschriebene Geschichten auch bekannter Autoren aus qualitativen Gründen ablehnt, während mancher Newcomer zwar gefördert, aber dank seiner ungewöhnlichen Perspektiven/ Ideen publiziert werden kann. Neben der Vorstellung des Namensgebers finden sich im Anhang zwei sekundärliterarische Artikel, die aus heutiger Sicht vor allem als Zeitfenster zum Stand der damaligen astronomischen Forschung betrachtet werden sollten. Einmal geht es um Schwarze Löcher und entsprechende Theorien zur Raumfahrt von Klaus Bruns, während sich Manfred Eigen & Ruthild Winkler mit „Intelligenten Automaten“ beschäftigen.
Bernd Kreimeier eröffnet die Anthologie mit seinem Bericht in Geschichtenform "...die solche Menschen hat..." . Eine neue Lebensform bedroht die Existenz des Homo Sapiens und sie ist im Grunde selbstverschuldet. Auch heute noch geht der kurzweilige Texte unter die Haut und stimmt nachdenklich, zumal insbesondere in der Tierwelt eben die Exzesse der Umweltzerstörung deutlich besser sichtbar sind als in Kreimeiers nachdenklich stimmender Spekulation.
Stephan de la Mottes « Alptraum » könnte den Reigen mit Post Doomsday Storys abschließen. Ob dieses Element wirklich notwendig ist, erscheint abschließend nicht stimmig. Vor allem weil einige Idee an eine kybernetische Variation irgendwo zwischen Crichtons „Westworld“ und Rainer Werner Fassbinders „Welt am Draht“ erinnern. Der Autor beschreibt eine seltsame, fast surrealistisch erscheinende Reise durch ein Europa, das in einigen Abschnitten von radioaktiver Verseuchung gekennzeichnet ist. Der Protagonist hat kein richtiges Ziel, wirkt getrieben, während auf der übergeordneten Handlungsebene die Entschlüsse getroffen werden, welche insbesondere der Autofahrer betreffen. Der Spannungsaufbau ist ausgesprochen zufrieden stellend und der Autor erschafft tatsächlich eine Art realistische, doch auch künstliche Welt, während die finale Konfrontation eben vor allem im Leser zu viele Fragen aufwirft und zu wenige schlüssige Antworten anbietet.
In einigen der Texte geht es um das Reisen. Dabei spielt es fast keine Rolle, ob diese Expeditionen tatsächlich stattfinden oder sich im Auge des Betrachters abspielen. Herbert W. Franke eröffnet diesen Reigen mit der Parabel „Sheeva wird kommen“, um den ewigen Wanderer, der in der Pointe das Ziel erreicht, an dem er im Grunde selbst gewartet hat. Ein kompakter, nachdenklich stimmender Text, dessen Gehalt sich vielleicht nicht gänzlich zufrieden stellend in der vorliegenden Form ausdrückt. Diethard van Heeses „Der Sprung“ erscheint dagegen wie eines der Märchen, welche die utopische Literatur vor dem Ersten Weltkrieg zu auszeichneten. Der Protagonist kann schließlich fast aus dem Nichts heraus gegen den Ratschlag seiner Familie den Traum vom interplanetarischen Fliegen umsetzen und zahlt dafür einen hohen Preis. Wie Pointe lenkt ein wenig vom Inhalt der Geschichte ab, dessen märchenartige Struktur fast subversiv unterminiert wird und vor allem zu viele Fragen offen lässt.
Die längste Geschichte stammt von Reinmar Cunis und könnte van Heeses Text entsprechen. „Eine Geschichte, von der ich manchmal träume“ ist eine klassische First Contact Story. Der Erzähler bleibt absichtlich auf einem Paradiesplaneten zurück, während seine Kameraden wieder zur Erde fliegen. Mindestens sieben Jahre muss er auf dieser Welt ausharren, bevor überhaupt Hilfe kommen könnte. Er nimmt Kontakt zu den primitiven Einheimischen auf. Der Planet ist eine Idylle. Er fragt sich, warum die anderen Menschen an Bord des Raumschiffs es nicht gesehen haben. Hier ahnt der Leser schon die Pointe, die Reinmar Cunis aus dem Nichts hervorzaubert. Sie ist selbst in den achtziger Jahren pragmatisch, konsequent, aber leider nicht besonders originell gewesen, so dass die Novelle lange Zeit sachte stimmungsvoll dahin plätschert, am Ende aber nicht über den obligatorischen Paukenschlag verfügt.
Jörg Weigands Story „Die Nacht der Lichtblitze“ könnte auch ohne phantastische Elemente alleine basierend auf Mythen funktionieren. In einer Hinsicht fügt sich der Text gut in den Komplex der Reisegeschichte ein, wobei der unbekannte Reisende aus dem Blickwinkel einer jungen Frau beschrieben und nicht selbst berichtend ein Stammesmitglied von einer im Grunde tödlichen Krankheit – die Würmer sind ekelig genug – mit sehr viel Energie und Wissen heilt. Der Heilungsprozess nimmt den breitesten Raum der gut geschriebenen Story ein, wobei wie angesprochen insbesondere die Auftaktsequenz impliziert, dass sie auf einer fremden Welt spielt und deswegen auch in den Bereich der First Contact Story platziert werden kann. Aber sie ist nicht nötig und im Gegensatz zu Herbert W. Frankes Allegorie konzentriert sich Jörg Weigand auf einen simplen, aber schlüssigen Plot und erzeugt mit dieser Vorgehensweise sehr viel mehr Spannung als Frankes „Sheeva wird kommen“.
Kai Riedemanns „Ein letzter Traum von Llarn“ dagegen könnte eine Verbindung zwischen den Reisegeschichten und den wenigen Dystopien dieser Sammlung darstellen. Die Protagonistin wird von einer anonymen, sich hinter den weißen Mauern der Verhörzelle versteckenden Allmacht befragt. Wie in „1984“ kann sie die Fragen weder einordnen noch wirklich beantworten. Am Ende steht die vielleicht imaginäre, vielleicht reale Flucht in einer andere Welt. Für den Leser und die Protagonistin beantworten sich durch das Ende die meisten Fragen, während die Diktatur des Staates – auch hier bleibt die abschließende Frage offen- an den Grenzen der Phantasie scheitern, im Grunde auch scheitern muss.
Rainer Erler nimmt in „Die Traum- Maschine“ die Idee von der Macht der Träume auf. Chronologisch steht die Arbeit der ehemaligen Filmemachers vor Kai Riedemanns stilistisch intensiverer Geschichte. In umgekehrter Publikationsabfolge gelesen verbinden sich aber die kurzen Texte vielleicht sogar unfreiwillig zu einem interessanten Alptraum. Rainer Erlers Story ist beginnend mit seiner technisch bodenständigen Prämisse zugänglicher, entwickelt sich aber schließlich auf den an sich selbst experimentierenden Protagonisten eine Reise durch sein Unterbewusstsein. Durch seine Zwänge und Wünsche, aber weniger seiner Träume.
Uwe Anton alias L.D. Palmers „Venus ist tot“ schließt diese Trilogie der (Wahn-) vorstellungen vielleicht sogar sehr zufrieden stellend ab. Mit bizarren Charakteren und absichtlich provokativen Dialogen vergeht der eigentliche Schöpfungsprozess buchstäblich im Fluge und löst sich anschließend auch wieder auf. Eine der ungewöhnlichen, aber auch in sich passenden Storys dieser Anthologie.
Hendrick P. Linckens satirische „In Heiners Hirn“ ist einer der literarische Exzesse, welcher entweder den Leser anspricht und zum Nachdenken animiert oder provozierend abgelehnt wird. Ohne wirklich grundlegende neue Ideen, eher von Stimmungen als einer stringenten Handlung getrieben ragt der Text durch die stilistische Experimente aus der Masse der eher stringent bis distanziert geschriebenen Texte der „Deneb“ Anthologie heraus. Aber „In Heiners Hirn“ ist noch mehr Geschmackssache, als es der Autor ursprünglich geplant hat.
Heinz J. Galle greift in "Als Peras aus der Puppe brach" das Thema einer Dikatur in der Postdoomsday Welt auf. Wie bei Bernd Kreimeier, aber konsequenter in die weitere Zukunft gedacht sind es die Menschen, die sich der zerstörten Umwelt anpassen müssen. Diese Prozesse geschehen niemals freiwillig und vor allem aktiv, sondern hinterlassen in der unterlegenen "alten" Rasse ein ordentliches Mißtrauen, das zu Kurzgeschlußhandlungen führt. Während Bernd Kreimeier sich mittels des Berichts um eine distanzierte Handlungsführung bemüht, schafft es Heinz J. Galle an einigen Stellen, die fremdartige Welt gut zu beschreiben, obwohl der zugrundeliegende Plot nicht unbedingt originell oder intensiv emotional genug erzählt worden ist.
Walter Ulrich Ewers "Angie" beginnt interessant. Vier Menschen in einem heruntergekommenen Hotel sind Ende der sechziger Jahre von einem besonderen Ereignis betroffen. Im Verlaufe der Story versucht der Autor diesen Moment aus unterschiedlichen Perspektiven zu extrapolieren und Spekulationen beizumischen, ohne abschließende Antworten zu geben. Dadurch verliert die Geschichte bis zum zu offenen Ende an Faszination und wirkt atmosphärisch nicht mehr so stimmig wie zu Beginn.
Gerd Maximovic hat in "Das Karem- Material" eine besondere und sehr originelle Art der First Conact Geschichte entwickelt. Dabei orientiert sich der Autor an den semidokumentarischen Stilrichtungen, die Rainer Erler zum Beispiel bei "Die Delegation" im Medium Film angewandt hat. Ein Raumschiff kehrt zurück, die an Bord befindlichen Berichte geben ein subjektives Bild der seltsamen Ereignisse; die mögliche Antwort stammt aus dem phantastischen Bereich der Spekulation und öffnet das Tor für weitere Expeditionen. Durch die wechselnden unzuverlässigen Perspektiven ist es weder für den Leser noch die Offiziellen zu erkennen, ob diese Aufzeichnungen wirklich real oder Ausbünde einer von Fremden manipulierten Phantasie sind. Das spielt auch keine große Rolle, denn die Welt, welche Gerd Maximovic hier aufs Papier zaubert, ist exotisch und irgendwie vertraut genug, um den Leser zu fesseln. Eine der besten Geschichten dieser Anthologie.
„Deneb“ ist eine solide Storysammlung mit einigen sehr guten Geschichten, aber auch einer Handvoll von Texten, die für die achtziger Jahren fast zeitgemäß mit dem warnenden Zeigefinger vor den Gefahren der Zukunft warnen, sich aber bei den alternativen Strategien stark zurückhalten und nicht selten auf Schemata zurückgreifen. Im Gegensatz zu den letzten „Sternenanthologien“ zeigt sich eine Tendenz zum thematischen Blockbildung und die guten Zeichnungen unter anderem von Jutta Winter und Themistokles Kanellakis erscheinen weniger abstrakt.
- Verlag: Wilhelm Goldmann,; Auflage: 1.A., (1981)
- Umfang 220
- ISBN-10: 3442234050
- ISBN-13: 978-3442234059
