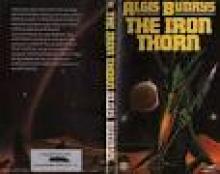
Algis Budrys “The Iron Thorn” ist auch unter dem Titel “The Amsirs and the iron Thorn” bekannt. Der Titel ist ein wenig missverständlich, denn auf dem fremden Planeten, der für gut zwei Drittel des Plots Hintergrund ist, gibt es mehr als einen dieser eisernen Dorne.
Auf den ersten Seiten wirft Budrys den Leser in ein archaisches Szenario. Honor White Jackson ist ein junger Mann an der Schwelle zum Erwachsensein auf einem fremden Planeten. Sein Stamm lebt in der Nähe eines der angesprochenen eisernen Dorne. Erst im Laufe der Handlung offenbart Budrys die Tyrannei einer um ihre Existenz kämpfenden Gesellschaft. Auf einem primitiven Niveau wird der Leser vor allem aus der entsprechenden zeitlichen Distanz an die Planwirtschaft der Sowjetunion erinnert. Den einzelnen Berufsgruppen möglichst keine Freiheiten schenken, da eigenes Denken zu einer Abweichung vom Plan führen könnte. Über Mangel soll Leistung gefördert werden. Vor allem die Bauern in der Nähe der Siedlung auf ihren ambivalent beschriebenen Feldern leiden unter diesem von einer kleinen Oligarchie von Herrschern aufgebauten Druck. Budrys bleibt bei seinen Beschreibungen pragmatisch oberflächlich und extrapoliert nur das Notwendigste. Mit dieser Vorgehensweise kann der Autor auch seinen Plot unter Kontrolle halten.
Wie bei den primitiven Stämmen ist es notwendig, dass die Jungen gestählt werden, in dem sie nach draußen in die „Wüste“ dieser Welt gehen, um einen der Amsir zu erlegen. Dabei handelt es sich um humanoide Wesen mit Flügeln, die über eine Art Sprache verfügen und mittels Speeren jagen. Die Menschen und die Amsir sind Feinde, obwohl beide wie sich später herausstellt in den Schatten der Dornen leben. Dass die Amsir über eine gewisse Intelligenz verfügen, wird den jungen Männern verschwiegen. Honor White Jackson nutzt eine interessante Vorgehensweise. Er geht über den Einflussbereich des Dornes hinaus und stellt sich der unwirtlicher werdenden Atmosphäre, um den Amsir in Sicherheit zu wiegen und ihn zu besiegen.
Mit der Aufnahme zu den Erwachsenen wird ihm ein Geheimnis nach dem Anderen offenbart. Für den Leser stellt sich angesichts dieser Prämisse die Frage, ob es wirklich möglich ist, in einer derartig konzentriert lebenden kleinen Siedlung so viele wichtige Geheimnisse zu bewahren? Budrys verzichtet auf eine entsprechende Artwort. Da sich Jackson auch aufgrund der offenkundigen Intelligenz seiner „Feinde“ bemüht fühlt, deren Kultur zu untersuchen mache er sich auf den Weg zu den Amsir und erlebt die andere Seite des Spiegels.
Schon in „Projekt Luna“ hat Budrys bewiesen, dass eine fremde Kulturen beschreiben kann. In dem angesprochenen Roman ist es eine unergründliche Maschine, die nicht nur zu einer Todesfalle, sondern auch zu einer kontinuierlichen Herausforderung wird. In „The iron Thorn“ scheint die ganze Welt über weite Strecken eine herausfordernde Spiel- und Experimentierfläche zu sein, auf welche sich zwei intelligente Rassen begegnen. In „Projekt Luna“ erfährt der Leser am Ende nichts über die Maschine und die potentiellen Sieger stehen sogar als Verlierer da. Emotional überfordert und förmlich ausgesaugt.
In diesem Roman wagt Budrys nicht den entsprechenden Schritt. Es ist eine ungewöhnliche First Contact Geschichte, in welcher kontinuierlich Fragen aufgeworfen werden. Dabei spielt der Autor sogar mit den Klischees des Genres , in dem er die Idee eines auf dieser Welt abgestürzten Raumschiffs mit der Erkenntnis, dass die Amsir über einen Dorn in einem besseren Zustand verfügen, wieder negiert.
Fast ironisch impliziert der Autor noch eine zweite First Contact Ebene in der zweiten Hälfte des Romans. Jackson trifft auf Menschen, die intellektuell im Grunde so weit weg von ihm seien müssten wie es realistisch zu beschreiben möglich ist. Aber auch hier überwindet das intensive von der Schiffsintelligenz auf dem Weg in die „Heimat“ gesteuerte Lernprogramm alle theoretischen Grenzen. Robert A. Heinleins Marsianer hatte es in „Ein Fremder in einer fremden Welt“ deutlich schwerer.
Jackson ist in allen Welten ein Außenseiter, der vor allem sich selbst immer hinterfragt und keine Antworten akzeptiert. Dieses kontinuierliche Forschen entspricht den klassischen literarischen Formen des Jugendbuches, das zwischen den Zeilen seine heranwachsenden Leser positiv formen soll. Aber mancher Ansatz wirkt eher mechanisch und vor allem schließt Algis Budrys in einen wichtigen Stellen zu wenig den Kreis, um letztendlich als belehrender, aber auch unzuverlässiger Erzähler ein Fundament zu etablieren, auf dessen Basis im Umkehrschluss eine „normale“ Science Fiction Handlung wieder entwickelt werden soll.
Mit dieser Prämisse impliziert der Autor die Idee eines kontrollierten Umfelds. Beide Kulturen leben in ihren isolierten Habitaten und die unwirtliche Atmosphäre zwischen ihnen verhindert zu viele Begegnungen. Dabei stellt sich die Frage, wer die Erschaffer der Dornen sind und welche Grundidee hinter dieser möglichen gigantischen Spielfläche steht. Kaum hat der Leser sich auch durch den Vorstoß Jackson zu den Amsir angefreundet, entzieht Budrys nicht nur seinem Charakter, sondern auch dem Leser dem letzten Mal den Boden unter den Füßen und sucht eine weitergehende Erklärung.
Jackson kehrt mit einem Amsir zum Ausgangspunkt des möglichen Experiments zurück und erlebt eine weitere, für ihn fremde Welt. Aus dem Nichts heraus formuliert Budrys eine erdrückende Anzahl von neuen Ideen und weicht von der Spielform ab, um ein vergessenes Experiment aus der Perspektive eines nicht unbedingt naiven Schläfers, aber eines Mannes zu heben, der Opfer und neugieriger Täter zu gleich sein könnte. Dieser Wandlung überrascht zuerst und wirft am Ende zu viele Fragen auf. Natürlich versucht Budrys soziale Konflikte mit dieser letzten Reise zu relativieren und die Unverträglichkeit unterschiedlicher Lebensformen und damit auch standesgemäßer Strukturen herauszustellen. Aber diese Vorgehensweise wirkt angesichts der Ausgangsprämisse und dem viel zu passiven Handeln der potentiellen Spielleiter zu platt, zu pragmatisch, um überzeugen zu können.
Vor allem Jackson nimmt jede Herausforderung ohne emotionale Schocks hin. Wenn er schließlich am Ziel der auch für den Leser überraschenden Reise ankommt, begrüßt er das Empfangs Komitee mit einer humorvoll selbstironischen Anspielung auf einen Klassiker der Literatur. Angesichts der vergangenen Zeit und den Umständen ist es erstaunlich, dass dieser Hinweis sofort aufgenommen wird, während andere Aspekte seiner „Heimkehr“ eher mit Skepsis betrachtet werden.
Vor allem konzentriert sich Budrys in der zweiten Hälfte des Buches auf diese neue Kultur, deren Wurzeln genauso angefault sind wie die stringente erdrückende Hierarchie auf Jacksons „Heimatwelt“ – er ist ja nicht auf der Erde geboren worden -, ohne die Ausgangslage noch einmal aus der Sicht der „Wächter“ Revue passieren zu lassen. Diese Verschiebung des Fokus im Allgemeinen und in Hinblick auf den ambivalenten wie ein Chamäleon erscheinenden Jackson tut der interessanten Ausgangslage des Buches nicht gut und viele angerissene Ideen gehen unter.
Es ist schade, dass Budrys gegen Ende des Plots von der herausfordernden und exotisch dreidimensionalen Landschaft dieser wirklich fremden und von ihm mit intensiven Beschreibungen zum Leben erweckten Welt abweicht, um im letzten Drittel nicht unbedingt alle Klischees zu bedienen, aber zu viele Aspekte zu relativieren und vor allem hinsichtlich der abschließenden Erklärungen sich von der sozialkritischen Ausgangslage in einer Extremsituation zu entfernen.
Wie fast alle Romane Budrys ist „The iron Thorn“ ursprünglich als Serial in einem der SF Magazine veröffentlicht worden. Der Plot wirkt, als wenn der Autor sich nach den ersten beiden überzeugenden Teilen anders entschieden hat. Die ursprüngliche Zielrichtung ist nicht mehr vorhanden und durch die Integration von technischen Ideen mit einem „Deus Ex Machina“ Hebel scheut sich der Autor vor einer weiteren Extrapolation der exotischen Welt und beschließt im Gegensatz zu seinem Protagonisten Jackson, einen einfacheren, pragmatischen und leider aus dem Nichts entstandenen Weg zu gehen, welcher die anfängliche Faszination dieses lange Zeit herausfordernd geschriebenen Buches unterminiert und nicht nur Jackson ohne Antworten auf nicht gestellte Fragen zurücklässt.
- Paperback: 160 pages
- Publisher: HarperCollins Distribution Services; New edition edition (28 Feb. 1980)
- Language: English
- ISBN-10: 0006154107
- ISBN-13: 978-0006154105
