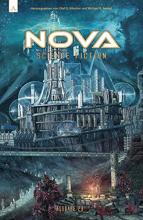
Die 23. Ausgabe des "Nova" Magazins ist zum ersten Mal seit langer Zeit wieder eine Themenausgabe. Die meisten Texte drehen sich um "Science Fiction und Musik" . Franz Rottensteiner leitet das Thema allerdings ein wenig zu eng an der als Quelle zitierten Vorlage ein. Vor allem das "Clarkesworld" Magazin hat in einer Reihe von Essays, die in absehbarer Zeit als Buch gesammelt erscheinen sollen, die enge Verbindung der Science Fiction Literatur mit durchaus progressiver Rockmusik aufgezeigt. Martina Claus- Bachmann muss wenig überraschend am Ende des zweiten sekundärliterarischen Artikels feststellen, dass musikalisch nichts von Menschen Erschaffenes wirklich fremd ist. Mit ihrem Titel "Das Fremde als Konstrukt- Musik und Science Fiction" hat sich die Autorin aber auch eine entsprechende Hürde erschaffen. Ihre Argumentationsketten sind manchmal ein wenig zu theoretisch und implizieren mehr Absichten als es wahrscheinlich die Künstler gehabt haben.
Bei den Kurzgeschichten wird unabhängig vom zugrundeliegenden Thema ein erstaunlich breites Spektrum nicht nur hinsichtlich der Qualität angeboten. Marcus Hammerschmitt liefert zum Auftakt eines der schwächsten Storys ab. "In Wien ist die Musik" beschreibt das Verhör eines Serienkillers durch die Polizei. Am Ende bleiben sehr viele Fragen offen. Da die Charaktere auch entsprechend schwach gezeichnet worden sind, wirkt die ganze Konzeption entsprechend statisch. Es ist schade, dass Hammerschmitt die ausschließlich implizierten Ansätze hinsichtlich des Mörders weiter extrapoliert hat. Auch bestehend Ähnlichkeiten zu Arthur C. Clarkes "Die neun Milliarden Namen Gottes", wobei Hammerschmitt sich durchaus zu Beginn bemüht, durch eine intensivere Zeichnung der Wiener Kultur sich von der bekannten Geschichte abzusetzen.
Gabriele Behrend dagegen zeigt auf, wie gute Science Fiction mit Themenbezug funktionieren kann. "Tremolo" liegt über weite Strecken eine klassische, klischeehafte Dreiecksbeziehung zu Grunde. Eine Frau zwischen zwei Männern mit dem zumindest phasenweise tragischen Ende. Nur ist die Frau der Schlüssel. In Gabriele Behrends Zukunft tritt Mia als Body Instrument auf. Ein Gast darf auf ihrem Körper spielen, so entsteht je nach harmonischer Beziehung unterschiedliche Musik. Ihr Mentor findet einen Mann, der sie auf eine besondere Art und Weise zum Klingen bringt. Sie gehen erfolgreich auf Tour, wobei die Eifersucht ihres Spielers sie mehr und mehr in die Isolation treibt. Am Ende muss sie in dieser erotischen, aber vor allem sehr originellen Geschichte lernen, auf eigenen Füßen zu stehen und sich selbst zu bespielen. Was in der Zusammenfassung albern und unglaubwürdig erscheinen könnte, ist in der zugrundeliegenden Story durch die dreidimensionale Zeichnung der Protagonisten aber durchaus nachvollziehbar und vor allem sehr lesenswert.
Auch Norbert Stöbe konzentriert sich eher auf eine Art "neue Musik", wobei der Autor in "Shamane" fast ein ganzes Leben auf wenigen Seiten zusammenfasst. Im Grunde schließt sich auch ein Kreis. Der Erzähler entwickelte eine neue Methode, Musik zu machen bzw. zu empfinden. Er wird nicht zuletzt dank seiner Inspiration und späteren Public Relationshipmanagerin in seiner Firma reich, um sich dann in die Einsamkeit zurück zu ziehen und ein Instrument tatsächlich spielen zu lernen. Wie bei Gabriele Behrend ist der Zwischenspurt mit der Musik aus einem Stirnband inklusiv eines entsprechenden pulsierenden dritten "Auges" aus den Trägern heraus faszinierend, aber Norbert Stöbe möchte lieber das Lebensschicksal eines Menschen beschreiben, der ganz oben im wirtschaftlichen Zenit erkennt, dass alles um ihn herum leer ist. Viele Ereignisse wirken zu stark gedrängt und der Funke zwischen den Figuren und dem Leser springt in Form der Kurzgeschichte nicht wirklich über, eine Novelle wäre das geeignetere Instrument gewesen.
Die dritte in diese Schublade passende Geschichte stammt von Thomas Adam Sieber. "Sodom Jazz Festival" beschreibt eine Welt, in welcher Tiere nicht nur intelligent gemacht worden sind, sie können mittels Modulen sprechen und Musik machen. Sie leben sogar mit Menschen in eheähnlichen Gemeinschaften inklusiv des entsprechenden Klatsches und Tratsches der Nachbarn über die jeweiligen Beziehungstaten. Der Autor präsentiert viele kleine Ideen wie den Jazz spielenden Schimpansen, der gleichzeitig der Erzähler ist. Nur fehlt es der Story an einem gängigen Plot, so dass sich die Grundidee neben der neuen Musik mittels Stirnband oder der Körpersymphonie in der Theorie gut verfolgen lässt, aber insbesondere im direkten Vergleich zu Gabriele Behrends Geschichte wie bei Norbert Stöbe nicht ganz zufriedenstellend auf einen Plot übertragen lässt.
Auch die Musikerbiographie „Le Roi est mort, vive le Roi!“ von Guido Seifert fällt in diese Kategorie. Es geht in dieser bedingt tragischen Geschichte um die Erschaffung von elektronischer Musik. Auch die übersetzte Gaststory „Saturn in g- Moll“ versucht diesen den Künstler manchmal zerreißenden kreativen Prozess in sprachliche Bilder einzugießen. Beide Geschichten haben das Problem, dass sie sich ohne Frage detailliert, manchmal zu spezifisch um den Prozess der Erschaffung von Musik kümmern, aber es den Autoren an Emotionalität fehlt, um die eigentliche Musik auch zum Leser zu transportieren. Das ist literarisch nicht leicht, sollte aber auf irgendeine Art und Weise vielleicht auch möglich sein. Stephen Kotowych aus Kanada zeichnet in „Saturn in g-Moll“ ein globaleres Bild eines exzentrischen Komponisten, zu dem ein junger Mann wegen seiner Abschlussarbeit reist. Die Komposition wird aufgrund des fast bizarr wie unrealistisch erscheinenden Aufwands nur einmal zu “hören“ sein, wobei sich die Frage stellt, wie eine derartige Übertragung vor allem zeitnah mit den Bildern im All wirklich möglich ist. Auf der Erde sollten „Schall“ und Bild unterschiedlich schnell auftreffen. Dass es sich bei dem Studenten um den Sohn des Komponisten und seiner einzigen Liebe handelt, ist ein wenig zu sehr dem Klischee geschuldet.
"Dr. Kojimas Cyber-Symphonic Orchestra" von Marc Späni steht thematisch zwischen den beiden Arbeiten Marcus Hammerschmitts und Gabriele Behrend. Der Erzähler geht auf die Suche nach seiner verschwundenen Freundin. Beide sind Musiker. In dieser Welt übernehmen immer mehr humanoide Roboter das Musikbusiness und bilden ganze Orchester. Das Ende ist in doppelter Hinsicht aber früh erkennbar und das Angebot, dass dem Erzähler gemacht wird, ist offenkundig. Wie bei Marcus Hammerschmitt handelt es sich um eine Verhörsituation, welche die Grundlage der Handlung bildet. Die Liebesgeschichte - sowohl zwischen dem Erzähler und der verschwundenen Freundin, als auch von beiden der Musik gegenüber - erinnert an Gabriele Behrends Story. Die überzeugend entwickelte emotionale Verbundenheit zwischen den Protagonisten ist auch die Stärke der inhaltlich wie angesprochen leider vorhersehbaren Story.
Im Klassikerbereich findet sich Thomas Zieglers "Unter Tage". Es ist aber nicht die einzige Story, die in den Tiefen spielt. Karsten Kruschels "Was geschieht dem Licht am Ende des Tunnels?" beschreibt eine Welt, in der die Mühlkippen der Zivilisation zu den neuen Quellen für Rohstoffe geworden sind. Wie de Kumpels früher graben sich ganze Teams in Bedingungen, welche an Sklaverei erinnern, durch diese Halden und fördern neben wichtigen Metallen /Edelmetallen auch einige Schätze der Zivilisation an die Oberfläche. Die verschiedenen Songtexte wirken dabei eher aufgesetzt; sie bilden keinen elementaren Bestandteil der Atmosphäre. Selbst die Monsteridee mit dem Übergang in eine andere Welt überzeugt nicht. Es sind vielmehr die dreidimensionalen intensiven Beschreibungen dieser sehr nahen Zukunftswelt mit ihren leider zu sehr vertrauten Zügen, welche den Leser provozieren und zum Nachdenken anregen. Sie machen den Reiz der vielleicht ein wenig zu gleichförmig, zu emotionslos geschriebenen Geschichte aus.
Zum vierten Mal präsentiert Michael Marrak einen Ausschnitt aus seinem inzwischen komplett in einer Ausgabe vorliegenden und ausgezeichneten „Kanon der mechanischen Seelen“. „Das Lied der Wind- Auguren“ wird von der mehr und mehr vertrauten fremdartigen Welt dominiert, welche Michael Marrak erschaffen hat. Dabei vergisst Michael Marrak im Gegensatz zu anderen Arbeiten auch nicht eine fortlaufende Handlung zu entwickeln. So begegnet Ninive einem besonderen havarierten Ringwesen, das nur mit der Hilfe eines sehr alten an Jahren Freundes gerettet werden kann. Auf der zweiten Handlungsebene werden Ninives Hausgeister in verschiedene Zukünfte geschickt, was ein wenig an die Weihnachtsgeschichte ohne Scrooge erinnert. Aber die sprachliche Intensität, die vielen skurrilen und doch irgendwie auch gleich vertrauten Ideen machen diesen Ausschnitt zu einem besonderen Lesegenuss.
„Cantus“ von Fran Hebben ist eine eher unbefriedigende Cyberpunk Geschichte mit einem blinden Datenkurier, der Musik aufnimmt. Zu kurz, zu improvisiert und schließlich auch zu offen endend.
Thomas Zieglers „Unten im Tal“ ist eine fast klassische Kritik am Kapitalismus, gespickt mit Thomas Zieglers ironisch zynischen Stil, der manchmal den Inhalt seiner Kurzgeschichten auch überdeckte. Dass die Mühlkippe ausgerechnet in Wuppertal ist, während die sich selbst überlassenen Astronauten um den Mond Io treiben, ist wahrscheinlich auch ein Seitenhieb auf seinen Freund Ronald M. Hahn, der als Nachlassverwalter die Geschichte dem Magazin zur Verfügung gestellt hat. Exzentrische Typen, pointierte doppeldeutige Dialoge, ein wenig Sex und die angesprochene Gesellschaftskritik machen den Nachdruck zu einem der Höhepunkte dieser „Nova“ Ausgabe.
Das Titelbild von Dirk Berger ist ein Augenfänger. Hinzu kommen mindestens solide, teilweise sehr gute Innenillustrationen zu den einzelnen Geschichten. Auch wenn das Thema Musik nicht unbedingt leicht in Worte zu fassen sind, versuchen die Autoren einzelne Aspekte des Themas mit einem Schwerpunkt auf den kreativen Geistern in Form fast teilweise ganze Leben umfassenden Biographien literarisch visuell umzusetzen. Nur wenige Geschichten hinterlassen einen unbefriedigenden Eindruck. Wie bei den „Phantastischen Miniaturen“ oder einigen „Exodus“ Ausgaben scheint der Druck, zu einem bestimmten Thema zu schreiben, die Autoren noch mehr anzuspornen und zu überdurchschnittlichen fokussierten Leistungen zu treiben. In diesem Punkt überzeugt „Nova“ 23.
- Taschenbuch: 198 pages
- Publisher: Amrun Verlag; 1 edition (17 Jun 2015)
- Language: Deutsch
- ISBN-10: 3958690319
- ISBN-13: 978-3958690318
