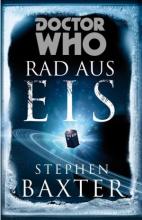
Cross Cult veröffentlicht mit Stephen Baxters "Rad aus Eis" einen "Dr. Who" Roman, der Anhänger der neuen, sehr erfolgreichen Fernsehserie befremden wird. Im Mittelpunkt steht der zweite Doctor, gespielt von Patrick Troughton zwischen 1966 und 1969. Also den Jahren, in denen der 1957 geborene Stephen Baxter selbst die Fernsehserie wie wahrscheinlich auch einige andere Prominente - im Vorwort wird sowohl Kim Newman als auch Paul McAuley gedankt - entdeckt haben. In den Jahren, in denen der Doctor trotz seines nicht immer subtilen Humors eher eine Art Vaterfigur für die beiden Begleiter Zoe und Jamie dargestellt hat. Auch geht es um die klassischen "Dr. Who" Schemen, in denen der Zeitreisende von seiner TARDIS quasi ferngelenkt Konflikte zwischen Menschen und Außerirdischen friedlich beilegen sollte. In einem derartig frühen Stadion, das insbesondere die arroganten Menschen nicht ahnen, wie nahe sie an der Vernichtung stehen. Dafür nimmt sich Baxter in der Tradition der damaligen Fernsehsechsteiler Zeit. Die Hommage geht soweit, dass der Leser fast die Cliffhanger zwischen den einzelnen Kapiteln fühlt. Unterstützt wird diese Vorgehensweise durch verschiedene Rückblenden, in denen insbesondere die Bewohner des Rades aus Eis - eine faszinierende Erfindung, die auf dem Papier natürlich besser funktioniert als bei den damaligen Budgets - sowie die fremde Wesenheit sich dann allerdings ein wenig zu menschlich vorstellen können. Zusätzlich ersetzen Exzentrik und ein ruhiger Handlungsaufbau die teilweise übertriebene, fast slapstickartige Action der gegenwärtigen Serie. Die Veröffentlichung des Romans sowohl in England im letzten Jahr als auch die gelungene deutsche Ausgabe mit einer nuancierten Übersetzung Claudia Kerns geht einher mit der Wiederentdeckung von hunderten, verschollen geglaubten BBC Episoden. Stephen Baxter bewegt sich allerdings auf einem schmalen Grad. Die frühen "Dr. Who" Folgen waren in erster Linie eine untypische Fernsehunterhaltung für ein jugendliches Publikum. Jetzt soll der Liverpooler generationsübergeifend mit seinem Buch ansprechen. Wer sich mit Baxters Werk auskennt, wird insbesondere in der zweiten Hälfte sehr viele Ideen aus seinen mehrbändigen Zyklen entdecken: Außerirdische, wirklich fremdartige Intelligenzen, die sich auf ungewöhnliche Art und Weise zu artikulieren beginnen.
In erster Linie wird es aber Stammanhängern der Serie darum gehen, wie gut ist Stephen Baxters diese Zeitreise in die sechziger Jahre mit gegenwärtigen Ideen gelungen? Baxters Doctor Who ist perfekt. Wer die alten Folgen in erster Linie dank der verschiedenen DVD Veröffentlichungen gesehen hat, wird in der vorliegenden Charakterisierung eines deutlich aktiveren Doctors keine Fehler finden. Selbst die Dialoge sind dieser Figur aus der Fernsehserie übernommen auf den Leib geschrieben. Claudia Kern hat sich beim schottischen Begleiter Jamie sehr viel Mühe gegeben, aber dessen einzigartige Floskeln sind kaum übersetzbar. Als Running Gag findet sich die Diffamierung Jamies zu einem "Opa". Eine absichtliche Provokation und wenn Jamie auf dem Mond des Saturns zum Dudelsack greift, um schottische Balladen zu spielen, steht der damalige Schauspieler Frazer Hines im Geist der älteren Generation wieder auf. Zoe leidet unter anderen Problemen. Nach den verschiedenen Reisen in ferne „Zukünfte“ - Baxter verstreut ausreichend Anspielungen auf andere Abenteuer geschickt über den ganzen Roman - muss sie mit einer Zeitzone fertig werden, die sehr nahe an ihrer eigenen Gegenwart ist und trotzdem unendlich weit entfernt erscheint. Dieser innere Zwiespalt dominiert die Figur im ersten Viertel des Buches, bevor die Action auf allen drei Handlungsebenen die Kontrolle übernimmt. Stephen Baxter gibt aber im Vergleich zu den damaligen Fernsehserien allen wichtigen Figuren ihre fünf Minuten des Ruhms und er lässt vor allem Jamie auch autark agieren, während Zoe mehr als einmal nur eine Art Resonanzkörper des Doctors für den Leser darstellt.
Mit dem "Rad aus Eis" als Hintergrund entfaltet sich eine interessante Geschichte. Der Doctor und seine Gefährten werden von der TARDIS quasi auf eine Zeitanomalie hingewiesen. Die TARDIS muss von einem intelligenten Roboter zu einer Bergbaukolonie auf dem Saturn geschleppt werden. Hier wird ein extrem seltenes Mineral abgebaut. Die Menschen leben in einer Halbdemokratie, die durch das Eindringen der Fremden, seltsame Todesfälle und schließlich das Auftauchen von außerirdischen blauen Puppen als Zeichen fremder Intelligenzen zu einer Diktatur des Kapitalismus wird. Die Bürgermeisterin symbolisiert diesen Wechsel. Während ihre beiden Kinder zusammen mit den Gefährten des Doctors die seltsamen Phänomene mit offenen Augen untersuchen, verschließt sie selbst ihre Augen - das Auffinden von Intelligenz würde die Abbaupläne zu Nichte machen und die Existenz der Kolonie auf den Monden des Saturns ad absurdum führen, eine fast klassisch klischeehafte Ausgangsposition für den bevorstehenden Konflikt - vor den unübersehbaren Zeichen und versucht die rebellierenden Jugendlichen mit drastischen Maßnahmen unter Kontrolle zu halten. Vielleicht erscheint es wie eine übertriebene Symbolisierung der Jugendproteste, welche die Welt während der Troughton Periode so erschüttert hat, aber Baxter hat schon in seinem ersten Jugendbuch diese Ära des eigenen Erwachens trefflich symbolisch charakterisiert. Ihr Ziel ist es, im Auftrage des Konzern möglichst viel von dem seltsamen und extrem seltenen Bernalium zu bergen, obwohl der Leser und kurze Zeit später der Doctor ahnt, das es einen Zusammenhang zwischen diesem Mineral und der außerirdischen Intelligenz gibt. Es wenig bemüht erscheint in dieser Hinsicht der Langzeitplan mit dem Amulett, das auf der Erde gefunden alle zehn Jahre Signale abgibt und von einer Generation zur anderen mit dem Ziel weitergegeben wird, den Saturn mit Raumschiffen zu erreichen. An die Spitze der Antagonisten stellt Stephen Baxter allerdings eindimensional Florian Hart. Ein typischer rücksichtsloser Kapitatalist, der die Bürgermeisterin manipuliert und an einer kurzen Leine führt. Sein "Ende" ist nicht nur symptomatisch, sondern stereotyp.
Mit der künstlichen Intelligenz MMAC fügt Baxter eine Figur dem Roman hinzu, die im Grunde die Gegenwart mit den sechziger Jahren verbindet. Das Schicksal eines im Grunde kleinen "Jungen" in einem Maschinenkörper, das viel zu sehr an Charles Dickens oder Brian W. Aldiss "Supertoy" Geschichte erinnert. Das er wie ein Mensch erzogen worden ist und inzwischen trotzdem zum alten Eisen gehört, ist ergreifend ohne kitschig zu sein. Aber auch die fremde Intelligenz, die sich anfänglich durch die blauen Puppen "artikuliert", die von den Erwachsenen ohne Rücksicht auf Verluste umgebracht werden, ist interessant gestaltet. Vielleicht verliert sie am Ende, wenn sie direkt mit den Lesern in einem zu ausführlichen Rückblick kommuniziert, ein wenig an Fremdartigkeit und Faszination, aber sie stellt eine moderne Schöpfung in einem positiv antiquierten Gewand dar.
Handlungstechnisch ist die Isolation der Menschen durch die von ihnen hervorgerufenen Geister ein klassisches Szenario. Wie oft sind die ersten beiden Doctos in isolierte Gesellschaften eingedrungen und konnten die Menschen vor ihrer Vernichtung retten? Da bewegt sich Stephen Baxter teilweise am Rand des Klischees, aber mit verschiedenen Ideen - die fernsehtechnisch nicht umsetzbar gewesen wären - durchbricht er den bekannten Rahmen immer wieder. Das reicht vom "Schlittenfahren" bis zum Vulkanausbruch auf dem Titan über die verschiedenen Rückblenden - Baxter greift Äonenweit zurück und lässt seinen Roman "Evolution" im Kleinen auferstehen - bis zu den wissenschaftlich modernsten Exkursen, in denen er die Entstehung der Ringe des Saturns genauso erläutert wie die unterschiedliche Beschaffenheit der Atmosphären. Alleine die Hautanzüge wirken für das Szenario zu modern, zumal es auf der anderen Seite keine entsprechende Kommunikation mittels Kurzwellenfunk oder gar Handys innerhalb der Station gibt.
Stephen Baxters spricht allerdings in erster Linie Fans der alten BBC Protagonisten an. Wer sich nicht mit Patrick Troughton und seinen Geschichten auskennt, wird die vielen kleinen Anspielungen überlesen. Wer die damalige Struktur der Geschichten - intelligente, aufmerksame Kinder sollen genauso angesprochen werden wie neugierige Erwachsene, die sich nicht belehrt fühlen dürfen - nicht akzeptiert, wird sich insbesondere nach dem guten Anfang auf den ersten Seiten langweilen. Baxter bewegt sich auf einem schmalen Grad zwischen bewundernder Hommage an die alten Folgen und Plot technischer Stringenz. Dem Leser dürfen die Eigenheiten der TARDIS nur aus der Sicht Dritter wie in der Fernsehserie erläutert werden. Zoe, Jamie und der Doctor akzeptieren die TARDIS als eigenständige und eigenwillige "Intelligenz". Daher ist es sinnvoll, sich mit dem alten "Dr. Who" Universum ein wenig vertraut zu machen, um von der ersten Seite an in diesem zeitgemäßen Kosmos die Geschichte zu verfolgen. Baxter bemüht sich immer, den Roman eher als Fernsehmehrteiler mit entsprechenden Höhepunkten oder Zwischenschnitten zu inszenieren und stellenweise spürt der aufmerksame Leser den Versuch, das Unmögliche auf das Budget der Serie zu reduzieren. Strukturtechnisch ist der Roman zufriedenstellend strukturiert und nach einem etwas zu phlegmatischen Mittelabschnitt zieht das Tempo positiv wieder an. Das Finale ist auf der einen Seite furios ohne gegen die etablierten Regeln der Serie zu verstoßen, auf der anderen Seite insbesondere für Stephen Baxters nicht selten distanziert belehrenden Ton gelingen ihm einige wunderschöne emotionale Szenen, welche in den sechziger Jahren dem Publikum direkt ins Herz gesprochen haben. Alleine das Verhalten der blauen Puppen, nachdem die Menschen einen der Ihren niedergeschossen haben, sei hier stellvertretend erwähnt.
Das "Rad aus Eis" ist beginnend mit der faszinierenden Konstruktion ein sehr unterhaltsames "Doctor Who" Abenteuer, das dem Zeitgeist geschuldet langsam, aber kontinuierlich an Geschwindigkeit gewinnt und gut unterhält. Die sich mehreren technischen Fehler werden erst Aberglauben oder gar Kobolden - die Idee der Gremlins ist ein wenig zu modern - zugeschrieben, bevor sich angetrieben von den Jugendlichen und der TARDIS Mannschaft die Erwachsenen mit dem Problem beschäftigen. Die Anspielungen auf das Schicksal vieler Jugendlicher in den britischen Bergwerken verpuffen allerdings wenig effektiv. Hier hätte Baxter mit ein wenig mehr Mut einen in mehrfacher Hinsicht auch sozialkritischen Roman verfassen können. Der Leser darf nur nicht mit der Erwartungshaltung der gegenwärtigen Fernsehserie an diesen auch äußerlich schön gestalteten, aber ein wenig zu großzügig gesetzten Band herangehen. Sonst wird er enttäuscht.

