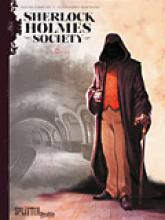
Das zweite Doppelalbum der “Sherlock Holmes Society” – der Reihenname könnte sich auf das ein wenig fragwürdige Ende mit einem Gesellschaftsarchitekten Sherlock Holmes beziehen – schließt unter dem passenden Titel „In Nomine Die“ die „Keeldoge Affäre“ ab. Es ist unabdingbar, den ersten Splitter Doppelband zu erst zu lesen. Die Handlung setzt nahtlos an. Dabei zerfallen diese beiden ursprünglich getrennt veröffentlichten Alben wie auch das erste Double in zwei sehr unterschiedliche Teile. Zuerst werden die Grundlagen weiter extrapoliert, bevor im "vierten" Band die Action dominiert und der Leser teilweise eher an eine Steampunk „Terminator“ Version mit Zombies als eine viktorianische Deduktionsgeschichte erinnert wird. Mit Hinweisen unter anderem auf die Zeitreisenden, denen Sherlock Holmes in einem anderen Abenteuer begegnet ist, fügt Autor Sylvain Cordurie die einzelnen Comicalben zu einem kompakten Paralleluniversum zusammen, in dem neben Werwölfen und Vampiren, dem Necronomicon und den angesprochenen Zeitreisenden auch ein Mr. Hyde – nachdem er sein Alter Ego Jekyll buchstäblich eliminiert hat – an der Seite des berühmten britischen Detektivs seinen Platz findet. Von den unzähligen Zombies in George Romero Manier mit Zeitraffereffekt ganz zu schweigen.
Durch die fortlaufende Handlung ist Cordurie auch gezwungen, einen eher schwächeren Aspekt aus dem Auftakt fortzuführen. Doktor Watson liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Seine Genesung macht nur geringe Fortschritte, was im Laufe der Handlung zu einem der nicht seltenen, aber für Kanonanhänger auch verwunderlichen emotionalen Ausbrüche des Detektivs führt. Das Aufsprengen des Duos Sherlock Holmes/ Watson wirkt sich vor allem im dritten Album der ganzen Serie – die französischen Originaltitel sind leider nicht übersetzt und als Zwischenschriften verwandt worden – nicht nachteilig aus, da Sherlock Holmes mit dem angesprochenen Mr. Hyde einen Partner wider Willen zur Seite hat, der Watson in einigen Aspekten sehr gut ersetzen kann. Cordurie macht aber im abschließenden vierten Album den inhaltlichen Fehler, diese beiden so unterschiedlichen und doch in ihrer jeweiligen Besessenheit auch ähnlichen Männer Holmes und Mr. Hyde sich nur spärlich wieder nähern zu lassen. Es ist vor allem Sherlock Holmes, der Mr. Hyde auf der einen Seite als Entwickler des Gegengiftes dringend benötigt, der auf der anderen Seite aber auch dessen konsequente Rücksichtslosigkeit bis hin zur verständlichen Paranoia sowohl den religiösen Fanatikern als auch der sehr ambivalent handelnden britischen Regierung nicht selten durch Mycroft Holmes vertreten gegenüber braucht. Während Sherlock Holmes zumindest in der Theorie ohne wirklich seine deduzierenden Fähigkeiten zeigen zu können oder gar zu müssen alleine durch seine Anwesenheit in einer nur bedingt glaubwürdigen Szene seine Feinde aus ihren Verstecken lockt, ist es der anarchistische Mr. Hyde mit seiner verschlagenen Brillianz, aber auch seinem Hang zur notwendigen Gegengewalt, der in einigen wichtigen Szenen für Spannung sorgt. Trotzdem ist das Ende des Handlungsbogens trotz einer fast an die Brutalität und die Exzesse eines Weltkriegs erinnernden Vernichtung vorhersehbar. Der Zeichner Alessandro Nespolino zusammen mit seinem Colouristen Ronan Toulhoat schafft es, Mr. Hyde das Leben zu schenken, das dem Leser/ Betrachter der Zeichnungen vor allem aus den frühen Stummfilmen bis hin zum Meisterwerk der vierziger Jahre aus dem Kino bzw. Fernsehen vertraut ist. Cordurie setzt dieser gelungenen Charakterisierung mit den ausgesprochen pointierten, zynischen Dialogen die Spitze auf, so dass Mr. Hyde in dieser exzellenten Form während seiner wenigen Auftritte nicht nur Sherlock Holmes mehrmals aus unterschiedlichen Lebensgefahren rettet, sondern vor allem als zynischer Katalysator den Meisterdetektiv wider Besseren Wissens antreibt. Die Szenen in dem extra von der britischen Regierung eingerichteten Labor gehören beginnend mit der exzellenten Kompositionen über die lebendige Mimik/ Gestik der Figur bis zu den angesprochenen hervorragenden Dialogen zum Höhepunkt des ganzen Albums. Es ist schade und wirkt leider oberflächlich, wenn Cordurie diese Janusidee – auch Sherlock Holmes zeigt zwei Gesichter, wobei er aufgrund der ihm eingeflössten Drogen die Bestie im Zaun halten kann, die Jekyll voller Inbrunst bis zur eigenen Vernichtung befreit hat – nicht zu Ende denkt und dem in dieser Hinsicht sehr schematischen vierten Album die notwendige Tiefe nimmt.
Wie eingangs angedeutet unterscheiden sich die im zweiten Band „In nomine dei“ zusammengefassten beiden Alben grundsätzlich voneinander. Im dritten Kapitel werden anfänglich fast alle losen Handlungsstränge der ersten beiden Bände aufgearbeitet, verfestigt und noch einmal die wichtigen Fakten zusammengefasst. Begleitet von soliden Dialogen, aber vor allem den hervorragenden Zeichnungen Nespolinos, dessen Stärken weiterhin viktorianische Gebäude und weniger individuelle Gesichtszüge sind, baut Cordurie eine entsprechend bedrohliche Atmosphäre auf, ohne den grundsätzlichen Plot voranzutreiben. Die Begegnung zwischen den Mitgliedern des Konzils und Sherlock Holmes stellt einen Wendepunkt dar. Es ist gleichzeitig die schwächste Szene der ganzen Geschichte. Sherlock Holmes kennt schon den wichtigsten Hintermann, er ist ihm nur nicht von Angesicht zu Angesicht begegnet. Der Hinweis auf Doktor Moriarty wirkt dabei wie ein doppelschneidiges Schwert. Während Sherlock Holmes Jahre gebraucht hat, um die Organisation des Napoleons des Verbrechens zu unterwandern und seine Macht zu zerbrechen, hat er beim Konzil es in nur sechs Wochen geschafft. Auf der anderen Seite hat das Konzil mit seinem grausamen Virus und mehr als dreißigtausend Toten mehr Schaden angerichtet als Moriarty in allen Sherlock Holmes Geschichten inklusiv der unzähligen Kanonepisoden oder Hommagetexten zusammen. Unabhängig von dieser schwachen Interpretation verfällt Cordurie unnötig in James Bond Muster, von denen sich die Geschichte auch durch einige exzellent dargestellte Actionszenen nicht mehr erholen kann. Sie erreichen die Atmosphäre des Anschlages auf die kleine irische Ortschaft zu Beginn der Geschichte nicht mehr.
Wichtige Teile des Plans werden dem hilflosen Sherlock Holmes expliziert wie unnötig mitgeteilt. Er wird gefangen zurückgelassen, aber nicht getötet. Er kann relativ schnell den Spuren folgen, auch wenn er für das erste fatale Ausbreiten der Seuche zu spät kommt. Das Konzil hätte einen kompletten Sieg erringen können, wenn sie Sherlock Holmes getötet oder zumindest mit genommen und als hilflosen Zeugen missbraucht hätten. Aber wie in unzähligen James Bond Filmen kann der Überheld sich sammeln und das geheime Versteckt der Schurken in diesem Fall mit einer kleinen von Hand ausgewählten Eliteeinheit erreichen. Parallel schafft es natürlich der von allen misstrauisch betrachtete Mr. Hyde, sein schon begonnenes Elixier zu vervollständigen und London zu retten. Diesem Abschluss fehlt die Komplexität, welche Cordurie vor allem im dritten Kapitel mit den verschiedenen, immer verzweifelter werdenden Treffen der verbliebenen britischen Regierung; dem Überwinden von Misstrauen gegenüber der nicht zu kontrollierenden Kreatur Mr. Hyde und schließlich der ins Leere laufenden Forschung hinsichtlich des Zombievirus so exzellent aufgebaut hat. Es sind diese Szenen, in denen Corduries Sherlock Holmes eher an den markanten britischen Detektiv erinnert als den agierenden oder lange Zeit in den ersten beiden Alben ausschließlich reagierenden Sonderagenten, der aus unzähligen Pulpvorlagen zusammengesetzt worden ist. Schon in anderen Geschichten hat der Franzose deutlich gemacht, dass Sherlock Holmes im Grunde eine Art Versatzstück ist. Die Geschichten könnten genauso funktionieren, wenn nicht der berühmte britische Detektiv, sondern Lester Dents „Doc Savage“ sowie „The Shadow“ oder einen Helden der Gegenwart nehmend eben der mehrfach angesprochene James Bond die Welt in Person Londons und des britischen Empires retten würden. Sherlock Holmes als Figur ist in der vorliegenden Präsentation über weite Strecken austauschbar. Wie Guy Ritchie bewiesen hat, spricht nichts gegen einen deutlich dynamischeren und weniger intellektuellen Charakter, aber im Verlaufe der ohne Frage über weite Strecken spannend angelegten Handlung wünscht sich der Leser einen deutlicheren Hinweis auf den Kanon im Allgemeinen – da reichen einzelne Hinweise nicht aus – und vor allem den britischen Detektiv im Besonderen.
Deswegen sind „Die Keelodge Affäre“ und „In nomine dei“ aber grundsätzlich eine schlechten Geschichten. Auch wenn die Täter angeblich Christen sind, dreht der Autor mit einem deutlichen Hinweis auf die fatale Fehlinterpretation der entsprechenden Glaubenslehren den Terroristen jeglicher Epoche bis hin zur Gegenwart effektiv den propagandistischen Hahn ab und entlarvt ihre Akte/ Taten als feige barbarische Angriffe auf die schutzlose Masse und nicht den dahinter stehenden Staat. Die politische Botschaft ist zeitlos und wird von Sherlock Holmes/ Dr. Hyde mit pragmatischen Bemerkungen als Blasphemie und vor allem Irrglauben entlarvt. Der Auftakt der Geschichte in „Die Keelodge Affäre“ ist nicht nur atmosphärisch ausgesprochen dicht, die grauen Bilder machen vor allem Zombie unerfahrenen Lesern Angst. Der Plotaufbau ist für eine Comicgeschichte über weite Strecken sehr dicht und vielschichtig, bevor der Fokus am Ende leider zu sehr auf bekannter Action liegt, die eher etwas im gegenwärtigen „Resident Evil“ Universum als einer viktorianischen Geschichte zu suchen hat.
Bis auf die individuellen Gesichtszüge – wieder ist es manchmal schwer, Sherlock Holmes von einigen Nebenfiguren zu unterscheiden – sind die Zeichnungen überzeugend und vor allem die Details des viktorianischen Englands werden liebevoll wiedergegeben, während die Farbgebung vor allem in den wichtigen Szenen überzeugend realistisch ist.
Nicht nur mit diesem Album und der weitgehenden Vernichtung Londons hat Cordurie seinen Sherlock Holmes aber endgültig in ein phantastisches Universum geschrieben, das immer weniger mit dem Kanon im Allgemeinen und dem Detektivgenre im Besonderen zu tun hat. Der Leser muss diese Hinwendung zum Übernatürlichen akzeptieren, sonst funktioniert nicht nur die „Sherlock Holmes Society“ für ihn nicht.
Autor
| Sylvain Cordurié | |
| Zeichner | Alessandro Nespolino; Ronan Toulhoat |
| Einband | Hardcover Splitter Verlag |
| Seiten | 112 Seiten Überlänge |
| Band | 2 von 2 |
| Lieferzeit | 3-5 Werktage |
| ISBN | 978-3-95839-276-2 |

